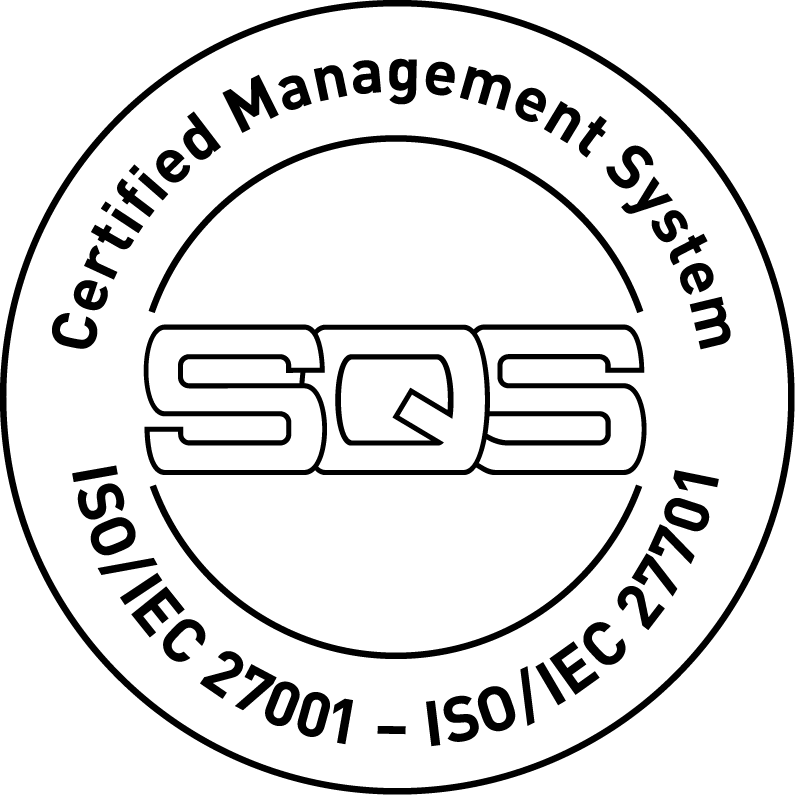Caroline Farmer ist Kodierexpertin und verantwortlich für die Sicherstellung einheitlicher Kodierpraktiken zwischen den Spitalzentren Oberwallis und Unterwallis. Als ehemalige erfahrene medizinische Kodiererin kennt sie die Entwicklung des Kodierwesens seit dessen Einführung und beherrscht das DRG-System in all seinen Facetten. Ihr Fachwissen macht sie zu einer wichtigen Zeugin in einem seit 2012 zunehmend komplexen Umfeld.
Was ist heute Ihre Rolle im Spital Wallis?
Ich sorge für die Kontinuität und Vereinheitlichung der Kodierpraxis zwischen den beiden Spitalzentren. Meine Funktion ist bereichsübergreifend: Ich entwickle Kontrollmechanismen zur Qualitätssicherung der medizinischen Kodierung in Zusammenarbeit mit den Teams vor Ort. Ich hatte das Glück, mit Data Analysts zusammenzuarbeiten, die mich in Tools wie Power BI und der Sprache DAX geschult haben. Dadurch kann ich heute Daten deutlich präziser auswerten. Da ich das Kodierwesen von Anfang an begleitet habe, kenne ich die Regeln, Klassifikationen und die Logik der verschiedenen Tarifstrukturen sehr genau, und kann medizinische, finanzielle und organisatorische Aspekte miteinander verknüpfen, etwas, was nur wenige Personen so beherrschen.
Welche grossen Veränderungen haben Sie seit Ihren Anfängen beobachtet?
In den Anfangsjahren arbeiteten im Spital Sitten zwei Kodiererinnen ohne medizinische Grundausbildung. Die Regeln waren einfacher, und es war möglich, auch Personen ohne vertiefte medizinische Kenntnisse einzustellen. Das ist heute undenkbar.
Die letzten Stellen, die ich besetzt habe, richteten sich an Ärztinnen und Ärzte oder spezialisierte Pflegefachpersonen. Wir haben nicht mehr die Zeit medizinisch auszubilden. Man muss in der Lage sein, eine Krankengeschichte zu lesen und korrekt zu interpretieren, Labordaten zu verstehen, den Schweregrad einzuschätzen, Zusammenhänge zu erkennen. Und all das hat direkten Einfluss auf die Abrechnung.
Musste sich auch die medizinische Dokumentation anpassen?
Ja, ganz klar. Früher weigerten sich manche Ärztinnen und Ärzte, ihre Austrittsberichte abzugeben oder ihre Behandlungen zu dokumentieren. Heute ist das nicht mehr tragbar. Eine präzise medizinische Dokumentation ist absolut zentral. Eine Diagnose ohne zusätzliche Spezifizierung reicht nicht mehr aus. Das hat auch die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und therapeutischen Personal verändert. Die jüngeren Generationen sind mit dieser Kultur aufgewachsen, das erleichtert vieles.
Wie haben sich Systemvorgaben wie Regulierungen, Tarife oder Kodieranforderungen verändert?
Die sogenannten „komplexen“ Codes haben alles verändert. Sie verlangen eine genaue Anzahl Behandlungsminuten, klare Einschlusskriterien und eine detaillierte Verlaufskontrolle. Man kann nicht mehr einfach einen Code zuweisen, man muss den gesamten Kontext strukturieren, dokumentieren und belegen. Da die Krankenkassen vermehrt Rückfragen stellen, muss die Dokumentation vollständig und strukturiert sein. In Bereichen wie der Rehabilitation sind wir von pauschalen Abrechnungen zu minutengenauen Behandlungsplänen übergegangen. Der administrative Aufwand ist enorm. Das ist längst keine Einzelleistung mehr, es braucht eine sorgfältige Vorbereitung im gesamten Behandlungsteam.
Wie haben sich die Spitäler organisiert, um diesen Mehraufwand zu bewältigen?
2003 sind wir von Pauschalabrechnungen auf AP-DRG umgestiegen, was eine personelle Verstärkung erforderlich machte. 2010 haben wir im Hinblick auf die Einführung der SwissDRG unsere Teams erneut aufgestockt, es gab neue Anforderungen und deutlich mehr zu dokumentierende Merkmale.
Wird die medizinische Kodierung vollständig intern durchgeführt?
Ja, grundsätzlich schon. Wir vergeben keine Kodieraufträge an externe Anbieter. Seit 2001 ist die Kodierung im Kanton zentralisiert. Unser Kodierteam ist gross genug, um den gesamten Bedarf intern abzudecken.
„Heute bringen Kodiererinnen und Kodierer solide medizinische Grundlagen mit, aber das reicht nicht mehr aus. Man muss die Kodierregeln beherrschen, Systemänderungen im DRG-Umfeld mitverfolgen, die finanziellen Auswirkungen verstehen, und gleichzeitig mit Tools wie Excel oder Power BI umgehen können.“
Caroline Farmer, Kodierexpertin am Spital Wallis .
Was sind aktuell die grössten Herausforderungen im Kodierbereich?
Rekrutierung, Nachfolgeplanung und Ausbildung, das sind die Dauerbrenner. Im Kodierbereich gibt es viel Fluktuation. Wenn jemand geht, müssen wir in der Lage sein, die Übergabe reibungslos zu gestalten. Gleichzeitig fehlt uns die Zeit, neue Kolleginnen oder Kollegen medizinisch auszubilden.
Ein weiteres Problem ist die Einhaltung der Fristen. Zwischen Patientenaustritt und Abschluss der Fallbearbeitung vergeht oft zu viel Zeit. Manchmal scheint die Akte vollständig zu sein, doch bei genauerer Analyse fehlen immer noch entscheidende Dokumente.
Wie unterstützen Sie mit Ihrer Kontrollfunktion die Zentren konkret?
Ich entwickle Prüfmechanismen, entweder proaktiv oder auf Anfrage der Zentren. Zudem erstelle ich Auswertungen, Analyseberichte und Kodierrevisionen. Ich arbeite häufig retrospektiv: Ich analysiere vergangene Jahre, verknüpfe Laborwerte, Leistungen, Medikamente, und erstelle Falllisten zur Überprüfung.
Die Zentren entscheiden dann selbst, ob sie die von mir gemeldeten Fälle öffnen oder nicht. Wir arbeiten mit einer gemeinsamen Datei, in der festgehalten wird, ob ein Fall Mehrertrag bringt oder nicht, und warum eine Kontrolle zielführend war oder nicht. 2024 konnten durch solche Kontrollen zahlreiche Kodierfehler korrigiert werden, meist zugunsten des Spitals. Das zeigt die Bedeutung dieser Arbeit.
Kodieren ist heute ein hochkomplexes Fachgebiet !
Absolut. Heute bringen Kodiererinnen und Kodierer solide medizinische Grundlagen mit, aber das reicht nicht mehr aus. Man muss die Kodierregeln beherrschen, Systemänderungen im DRG-Umfeld mitverfolgen, die finanziellen Auswirkungen verstehen, und gleichzeitig mit Tools wie Excel oder Power BI umgehen können.
Diese Vielfalt an Kompetenzen ist schwierig zu vereinen. Hinzu kommt der zwischenmenschliche Aspekt, ohne offene Kommunikation mit allen Teams und auch innerhalb der Abteilungen ist die Kodierung oft unvollständig. Es ist ein Beruf an der Schnittstelle verschiedener Fachwelten.
Welche Rolle spielen IT-Tools in diesem Zusammenhang?
Früher teilten sich drei Kodiererinnen einen Computer. Heute ist die digitale Infrastruktur unverzichtbar. Die Spitalplanung bringt viele Anforderungen mit sich, etwa Mindestfallzahlen zur Aufrechterhaltung bestimmter Fachbereiche. Softwarelösungen helfen uns, diese Anforderungen zu erfüllen.
Entsprechen die Ihnen zur Verfügung stehenden Tools Ihren Bedürfnissen?
Wir verfügen über gute Tools, etwa Business Object oder Power BI – aber sie stossen an Grenzen. Vor allem, weil sich die Kodierregeln ständig ändern. Und: Es fehlt an Interoperabilität. Viele Systeme lassen sich nicht sauber miteinander verbinden. Um zu Ergebnissen zu kommen, sind immer noch viele manuelle Eingriffe notwendig. Ich träume von einer Lösung, die alles integriert, aber das ist nicht Aufgabe eines Spitals. Und unsere Budgetvorgaben zwingen uns dazu, kreative Lösungen zu finden.
Was halten Sie vom Einsatz künstlicher Intelligenz im Kodierbereich?
Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Einerseits bin ich begeistert, KI kann vereinfachen, automatisieren, und Analysen umfassender machen.
Aber Datenschutz ist ein sehr sensibles Thema. Auch die Datenbasis, mit der man eine KI füttert, ist kritisch, falsche Eingaben können zu Verzerrungen führen. Wir müssen schrittweise vorgehen.
Ich glaube, die Anforderungen in öffentlichen Spitälern unterscheiden sich stark von denen spezialisierter Privatkliniken, die planbare Eingriffe wie Prothesen durchführen. Aber ich hoffe, dass uns KI bald helfen wird, den Analyseaufwand im Vorfeld des Kodierprozesses zu reduzieren. Ich verfolge die Entwicklung entsprechender Anwendungen mit grossem Interesse.
Die gebürtige Kanadierin Caroline Farmer begann ihre Karriere am CHUV im Jahr 1999. Später wechselte sie ins Spital Wallis, wo sie die Einführung der medizinischen Kodierung zuerst im Spital Sitten und anschliessend kantonsweit mitgestaltete. 2017 wurde die Kodierung im Kanton dezentralisiert. Seither ist sie in einer übergreifenden Funktion tätig und für die Kodierkontrolle in den Spitalzentren des Ober- und Unterwallis verantwortlich.
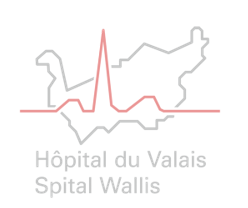
Ähnliche Artikel

Meet the team Regina
Wir freuen uns, Regina Hoffmeister willkommen zu heissen. Sie startet im September 2025 und verstärkt das Kodierteam in der Deutschschweiz.

Meet the team Marie
Marie Gargallo ist im September zu Swisscoding Technologies gestossen, um die Geschäftsentwicklung unserer KI-basierten Codierungslösung CODY zu unterstützen.