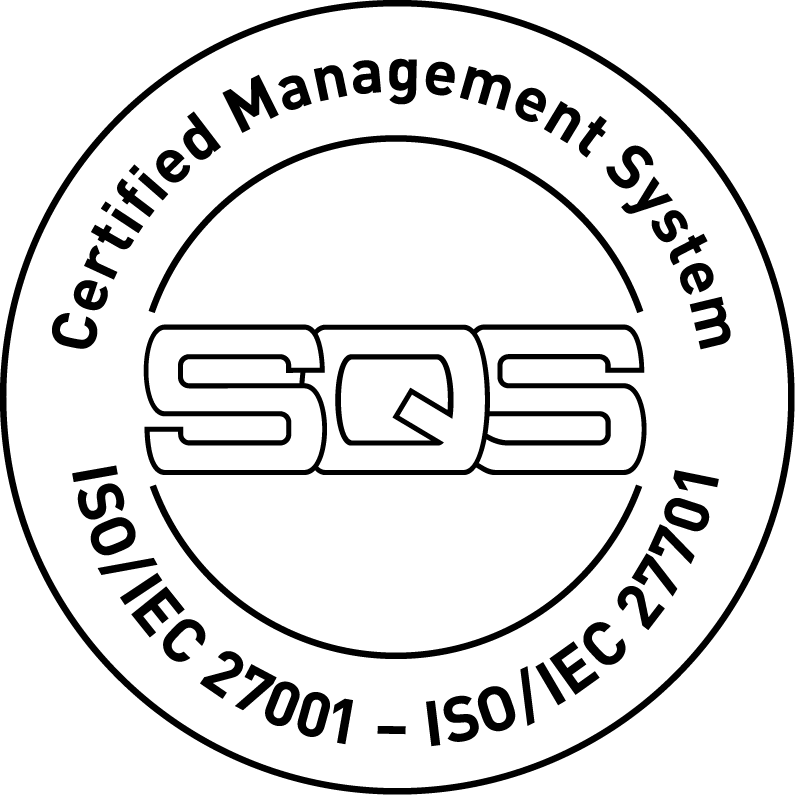Als Finanzdirektor des «Hôpital de La Tour» bringt Pierre-Antoine Binard 25 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement mit, davon 8 Jahre im Gesundheitswesen. Als Verantwortlicher für die klassischen Finanzfunktionen sowie für das Partnerschaften-Management mit den Versicherungen und der Fakturierung, beobachtet er täglich wie die zunehmende administrative Komplexität die Ressourcen des Spitals belastet.
Welche Bedeutung hat die medizinische Kodierung in Ihrem Verwaltungsbereich als CFO des Spitals?
Die medizinische Kodierung ist das Herzstück unserer administrativen Kette. Im stationären Bereich ist sie buchstäblich der „Reaktor“ der Fakturierung. Der stationäre Bereich macht bei uns rund 50 % des Umsatzes aus, mit etwa 9’000 Fällen, das verdeutlicht sowohl das Volumen als auch die Tragweite. Von der medizinischen Kodierung hängt die Anerkennung der Fallkomplexität und die Richtigkeit der Abrechnung ab.
Das Hôpital de la Tour hat sich dafür entschieden, die medizinische Kodierung intern zu verwalten. Welche Vorteile und Herausforderungen bringt das mit sich?
Die interne Kodierung ist eine strategische Entscheidung. Sie ist zentral für die Fakturierung, den täglichen Austausch mit den Ärzten und die Berechnung ihrer Honorare. Sie erhöht die Sicherheit der Dossiers, reduziert Missverständnisse und minimiert Rückweisungen. Doch dieser Entscheid hat seinen Preis: Kodierer sind selten und sehr gefragt, ihre Ausbildung ist langwierig und kostspielig, und ihre Kompetenzen müssen laufend aktualisiert werden, da sich die Medizin rasch weiterentwickelt. Unsere Teams sind auf eine präzise Volumetrie abgestimmt, was eine echte Herausforderung darstellt – ein Abgang oder eine Abwesenheit wirkt sich sofort auf die Produktivität aus. Hinzu kommt, dass die laufenden Tarifreformen (Tardoc, ambulante Pauschalen, neue Abrechnungsmodelle) die Belastung zusätzlich erhöhen. In diesem Umfeld zählt jede Ressource, und das Gleichgewicht bleibt fragil.
Wie gestaltet sich die Kommunikation mit den Ärzten in Kodierungsfragen?
Die Kommunikation mit den Ärzten ist nicht immer einfach. Es handelt sich um hochspezialisierte Fachärzte, die nicht unbedingt bereit sind, sich auf Diskussionen über Operations- oder Austrittsberichte einzulassen. Deshalb muss der Austausch auf wissenschaftlicher Ebene erfolgen, mit einer Terminologie, die für sie relevant ist. Das ist nicht immer angenehm, doch das Interesse ist geteilt: Ein vollständig und korrekt kodierter Fall nützt sowohl der Institution als auch dem Arzt.
Wie erleben Sie die zunehmenden administrativen Anforderungen, die immer mehr Ressourcen beanspruchen und sogar die Einbindung der Ärzte in einen Bereich erfordern, der eigentlich nicht zu ihrem Kerngebiet gehört?
Es gibt heute eine deutliche Zunahme administrativer Anforderungen, insbesondere seitens der Versicherungen, teilweise auch seitens des Kantons, die immer mehr Unterlagen zur Prüfung der abgerechneten Beträge verlangen: medizinische Berichte, Materialeinsatz, Aufenthaltsdauer usw. Dies führt auch zu einer steigenden Zahl an Rückweisungen. Dazu kommen die ständigen Tarifänderungen – Tarmed, der zukünftige Tardoc, ambulante Pauschalen, Privatvergütungen – die jedes Mal umfangreiche Anpassungen erfordern. Das Beispiel von Asteriks zeigt dies deutlich: Die Integration dieses neuen Systems hat uns massiv verlangsamt.
Diese Intensivierung der Verwaltung ist, meiner Meinung nach, bemerkenswert, und ich bin mir nicht sicher, ob die Medizin davon profitiert. Sie zwingt die Spitäler, ihre Teams für Kontrollen auszubauen, wodurch Ressourcen gebunden werden, die dann anderswo fehlen. Es ist eine Spirale, die das System belastet und die Investitionsfähigkeit der Institutionen einschränkt.
Am meisten überrascht mich das Fehlen einer Diskussion über die Qualität: Die Debatten sind rein administrativ und blenden aus, was für mich das Herz und die Stärke des Gesundheitssystems darstellt. In seinem Werk Livre blanc pour une Santé dans le rouge schreibt Dr. Thierry Glauser: „Die freie Medizin wird derzeit systematisch geschwächt – durch eine Kombination aus Tarifreformen, strukturellen Ungleichgewichten zwischen öffentlichem und privatem Sektor, finanzieller Intransparenz, administrativer Überlastung und Verlust klinischer Souveränität.“ Manchmal sind sich Finanzwelt und Ärzteschaft durchaus einig!
„Diese Intensivierung der Verwaltung ist, meiner Meinung nach, bemerkenswert, und ich bin mir nicht sicher, ob die Medizin davon profitiert. Sie zwingt die Spitäler, ihre Teams für Kontrollen auszubauen, wodurch Ressourcen gebunden werden, die dann anderswo fehlen. Es ist eine Spirale, die das System belastet und die Investitionsfähigkeit der Institutionen einschränkt.“
Pierre-Antoine Binard, CFO des Hôpital de La Tour
Wie beeinflusst die aktuelle finanzielle Lage der Spitäler ihre Fähigkeit, zu investieren und die Qualität der Versorgung zu sichern?
Die finanzielle Situation der Spitäler ist angespannt und wirkt sich direkt auf ihre Investitionsfähigkeit aus. Die Margen schrumpfen, während der Bedarf an Personalschulung, Erneuerung von Geräten und Integration neuer Technologien steigt. Ich zitiere gerne einen deutschen Bundeskanzler: „Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen.“ Laut PwC erreichen jedoch zwei Drittel bis drei Viertel der Spitäler nicht die Rentabilitätsschwelle von 10 % EBITDA, viele weisen sogar ein Eigenkapitaldefizit auf. Auch die Berichte der ZKB zeigen die chronische Unfähigkeit der Spitäler, ihre Investitionen aus dem operativen Cashflow zu finanzieren.
Gleichzeitig verstärken administrative Auflagen und Tarifsenkungen den Druck zusätzlich. Private Spitäler ohne Zugang zu öffentlichen Subventionen müssen diese Last allein tragen, während öffentliche Einrichtungen durch Steuergelder gestützt werden, für den Steuerzahler oftmals wenig transparent. In diesem Kontext gilt: Jeder Franken, der in Verwaltung, Kontrollen oder Antworten an Versicherungen investiert wird, ist ein Franken weniger für die Verbesserung der Versorgungsqualität, die Weiterbildung der Teams und die Sicherung medizinischer Exzellenz. Wenn sich nichts ändert, sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Inwieweit könnten neue Technologien und intelligente Tools Ihrer Meinung nach die Kodierung verändern und den Abrechnungsprozess entlasten?
Mit Sicherheit, denn sie werden die Weiterentwicklung des Kodierungsberufs ermöglichen. Dank Tools, die medizinische Dokumente mit sehr geringer Fehlerquote lesen und interpretieren können, lassen sich einfache Fälle bereits heute automatisch kodieren. Das wird langfristig die Qualität steigern und vor allem den Kodierern Zeit verschaffen, um sich auf komplexe Dossiers zu konzentrieren – Fälle, die einen echten Dialog mit den Chirurgen und spezifische medizinische Expertise erfordern. KI ersetzt den Menschen nicht, sondern steuert das Volumen, sodass sich die Fachkompetenz dort konzentrieren kann, wo sie den grössten Mehrwert bietet.
Darüber hinaus könnten solche Technologien den administrativen Prozess von der Anfrage auf Kostenübernahme bis zur Zahlung grundlegend modernisieren. Heute befinden wir uns noch im „Steinzeitalter“: Anfrage auf Kostenübernahme, Versicherungsklasse, Leistung müssen mit mehreren Vertragsparteien – Kanton, Arzt, Versicherung, Patient, Einrichtung – bestätigt werden. Und selbst nach erfolgter Behandlung erfolgen weitere Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Das ist ein immenser Zeit- und Energieaufwand für nichtmedizinische Aufgaben. Technologisch wäre es durchaus denkbar, dies zu vereinfachen: Sobald eine Leistung akzeptiert und erbracht wurde, sollte die Zahlung automatisch erfolgen. Tools wie die Blockchain könnten diese Nachvollziehbarkeit sicherstellen und die Verwaltungskosten für Vor- und Nachkontrollen erheblich reduzieren.
Dazu ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren erforderlich. Halten Sie das für realistisch?
Ja, ich halte das für möglich. Irgendwann werden ein Kanton und eine Versicherung den Nutzen eines Pilotprojekts erkennen, und wir würden sehr gerne daran teilnehmen. Wenn dies dazu beiträgt, die Verwaltungskosten auf beiden Seiten zu reduzieren, sollte man nicht zögern.
Braucht es dazu einen externen Akteur, um diesen Dialog zu initiieren oder die Beteiligten zusammenzubringen?
Ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist. Entscheidend ist, die richtigen Personen an einen Tisch zu bringen: einen Arzt, einen Patienten, eine kantonale Vertretung, eine Versicherung und eine Institution. Wichtig ist, es einfach zu versuchen. Es wäre nicht schwierig umzusetzen, und man könnte den administrativen Prozess einer Hospitalisierung endlich konsequent digitalisieren.
Es wird oft über Swisscoding im stationären Bereich gesprochen, aber man darf nicht vergessen: Das Volumen im ambulanten Bereich ist hundertmal grösser. Natürlich liegt das Potenzial für Entlastung im stationären Bereich auf der Hand, wegen seines administrativen Aufwands. Aber auch der ambulante Bereich wäre ein ideales Feld für Innovationen. Dies könnte über Akteure wie die Ärztekasse, Honorarfakturierungsstellen wie Asteriks oder VVG+, Medicalculis oder auch externe Anbieter wie PwC oder ELCA geschehen, die ein entsprechendes Konzept entwickeln könnten. An Ideen und Partnern mangelt es nicht, es braucht lediglich den gemeinsamen Willen, diesen Schritt zu gehen.
Ähnliche Artikel

Meet the team Regina
Wir freuen uns, Regina Hoffmeister willkommen zu heissen. Sie startet im September 2025 und verstärkt das Kodierteam in der Deutschschweiz.

Meet the team Marie
Marie Gargallo ist im September zu Swisscoding Technologies gestossen, um die Geschäftsentwicklung unserer KI-basierten Codierungslösung CODY zu unterstützen.